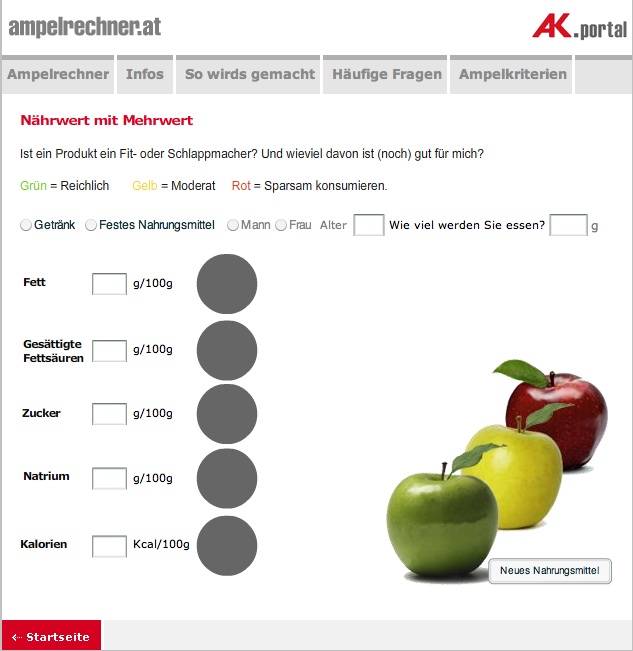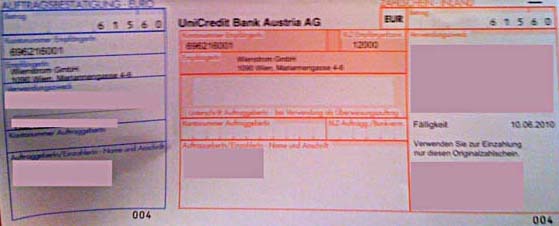Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat mobiles Internet getestet. Demnach erreicht kein Anbieter die in der Werbung versprochene Geschwindigkeit und die Sicherheit in der Verbindung ist auch mangelhaft:
Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat mobiles Internet getestet. Demnach erreicht kein Anbieter die in der Werbung versprochene Geschwindigkeit und die Sicherheit in der Verbindung ist auch mangelhaft:
Unerwartet niedrige Geschwindigkeit, Verbindungsabbrüche und teils hohe Kosten bei Überschreitungen: Das ist die andere Seite des mobilen Breitband – abseits der schönen neuen Werbewelt. “Mobiles Breitband ist derzeit kein vollwertiger Ersatz für das Internet über Kabel oder Telefonleitung. Meist heißt es nur Schmalspur statt Breitband. Denn bei keiner einzigen Messung erreichten die mobilen Internetzugänge die in Aussicht gestellte Geschwindigkeit bei Down- und Upload. Statt mit Hochgeschwindigkeit am Datenhighway zu brausen, bleibt man im Datenstau stecken”, kritisiert VKI-Geschäftsführer Franz Floss.
Ob im Zug, Park oder Kaffeehaus – der mobile Breitbandzugang ermöglicht “Arbeit, Spaß und Spiel” wo immer es beliebt, verspricht die Werbung. Mit einem “wieselflinken”, “sagenhaft günstigen Surferlebnis” lockt so mancher Anbieter. Doch Werbeslogans wie “ohne Datenbremse”, “viel downloaden, wenig zahlen” oder “überall und übergünstig” halten nicht immer, was sie versprechen. Das zeigt ein Vergleichstest des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), der zehn Angebote (Vertrag und Wertkarte) der vier nationalen Netze auf
Geschwindigkeit, Handhabung und Kosten untersucht hat.
Der starke Kontrast zwischen Schein und Sein ist auch Peter Kolba, Leiter des Bereichs Recht im VKI, ein Dorn im Auge, “Wenn bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde versprochen werden, aber nicht einmal ein Drittel dessen erreicht wird – ohne dass in der Werbung deutlich darauf hingewiesen wird – bewegt man sich bereits hart an der Grenze zur irreführenden Werbung. Hier prüfen wir Klagen nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.”
Trotz der harschen Kritik gibt es auch einen Testsieger: A1 netbook + Premium 5 GB setzte sich im Gesamtranking durch und konnte besonders bei der Geschwindigkeit punkten – bei der Überschreitung des 5 GB Transferlimits werden allerdings Kosten von 102,40 Euro pro GB fällig. Auf den hinteren Rängen finden sich bob breitband 1 GB, yesss Mobiles Internet Starterpaket und tele.ring free WILLI mit dem Testurteil “durchschnittlich”.
Eine enorme Diskrepanz zwischen Werbung und Wirklichkeit stellten die Tester bei den Downloadgeschwindigkeiten fest. Die Anbieter von mobilem Breitband versprechen zwar Downloadraten von “bis zu” 7,2 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Die getesteten Produkte von yesss, T-Mobile, 3 Hutchison (3Data Laptop 5 GB) und der Telekom Austria erreichten im gut ausgebauten Stadtgebiet jedoch im Durchschnitt nur ein Drittel der ausgelobten Geschwindigkeit. Absolut gesehen lieferten orange (netbook + Mobiles Internet), yesss (Mobiles Internet Starterpaket) und tele.ring (free WILLI) die schlechtesten Messergebnisse und erhielten in dieser Kategorie dafür ein “nicht zufriedenstellend”. A1 hängte die Konkurrenz hingegen mit den höchsten Spitzengeschwindigkeiten und den kürzesten Einbrüchen ab.
Wortwörtlich unverbindlich sind “bis zu”-Angaben auch in anderer Hinsicht. Denn sie enthalten nicht die Garantie, dass an dem Ort, an dem das Internet benötigt wird, überhaupt eine Verbindung zustande kommt. Der Testversuch, eine 28 MB große Programmdatei herunterzuladen, gelang an allen Standorten mit keinem der vier Provider auf Anhieb. Bei 3 Hutchison waren mitunter gleich drei Versuche notwendig, da der Download wiederholt zum Stillstand kam. Aus 28 MB wurden so 50 MB verbrauchtes Datenvolumen.
“Heikel sind Downloads von Dateien mit einer Größe von mehr als 100 MB, weil hier die Wahrscheinlichkeit eines ungewollten Abbruchs besonders hoch ist. Allein der aktuelle Adobe Reader hat aber mehr als 200 MB”, informiert Testleiter Paul Srna. “Schon eine kleine örtliche Veränderung, ob nun im Kaffeehaus oder in der Wohnung, kann aber den Empfang deutlich verbessern. Hilfreich ist auch ein USB-Verlängerungskabel, mit dem man den Stick in Fensternähe platzieren kann. Wer vorrangig in den eigenen vier Wänden mobil sein möchte, sollte aber besser in einen WLAN-Router investieren.”
Die Frage nach dem günstigsten Anbieter ist heikel, da die monatlichen Kosten vom gewählten Tarifmodell beziehungsweise vom real verbrauchten Datendurchsatz abhängen. Bei den Einmalkosten fallen hier in der Mehrheit zwischen 50 und 60 Euro an. Die Kosten für ein Gigabyte (GB) reichen bei den Verträgen von rund zwei Euro (3 Hutchison 3Data Laptop 5 GB) bis rund acht Euro (T-Mobile) – wenn man das inkludierte Datenvolumen auch ausnützt. Bei den Wertkarten (3 Hutchison, yesss und tele.ring) sind die Kosten pro Gigabyte mit 20 Euro zwar höher, böse Überraschungen beim Überschreiten des Datenvolumens aber ausgeschlossen. Anders bei den Verträgen: 3 Hutchison und A1 verrechnen bei einer Überschreitung von 1 GB einen Aufschlag von 102,40 Euro, der Rest drosselt auf ein Schneckentempo.
“Die Frage nach dem günstigsten Anbieter ist also auch eine Frage der Nutzung. Sofern man mobiles Breitband als Ergänzung für unterwegs verwendet, ist die Wertkarte ohne monatliche Fixkosten oft die sinnvollere Variante. Wer dieses vorrangig und regelmäßig nutzt, fährt in der Regel mit einem Vertrag besser”, so Srna. “Grundsätzlich sollte dabei für den durchschnittlichen User eine Downloadgeschwindigkeit von 1 Mbit/s und eine Datenmenge von 5 GB im Monat vollkommen ausreichen.”
Besonders teuer kann das mobile Surfen im Ausland werden. Zumindest im EU-Raum soll die EU-Roaming-Verordnung Horrorrechnungen aber verhindern. Dieser zufolge müssen europäische Mobilfunknetzbetreiber seit dem 1. März 2010 ihren Kunden die Möglichkeit einer Rechnungsobergrenze anbieten. Für Kunden, die bis 1. Juli 2010 nicht von sich aus eine Obergrenze festgelegt haben, gilt pauschal die Obergrenze von 50 Euro (exkl. Ust). Zudem erhalten die Kunden eine Warnmeldung, wenn ihre Kosten 80 Prozent des jeweils definierten Betrages erreicht haben. “Das ist an und für sich eine gute Sache. Warum sich eine solche Warnung bei Erreichen des Datenlimits aber lediglich auf die Nutzung des Internets auf Reisen in anderen EU-Ländern beschränken sollte und in Österreich selbst ausgespart bleibt, ist uns nicht klar. Hier ist eindeutig noch Handlungsbedarf gegeben”, kritisiert Kolba.
Als Ärgernis empfindet Kolba die im Test festgestellte grobe Unterschreitung der ausgelobten Downloadgeschwindigkeiten: “Das wird Gegenstand der Überprüfung von UWG-Klagen sein, sofern dies nicht deutlich in der Werbung klargestellt wird. Diese Situation mag auch vergleichbar mit der Judikatur des deutschen Bundesgerichtshofes sein, derzufolge der reale Kraftstoffverbrauch um nicht mehr als 10 Prozent von den in der Werbung angegebenen Werten abweichen darf. Im vorliegenden Test wurden dagegen teils nicht einmal Werte von einem Drittel des Angegebenen erreicht. Man darf sich also nicht wundern, wenn Kunden Gewährleistung fordern.”
Weitere Kritikpunkte ergeben sich bei einem genaueren Blick auf das Kleingedruckte: Das gilt nicht zuletzt für Verträge mit “unlimitiertem” Surfen oder “Fair Use”. So wird auch hier bei Erreichen einer bestimmten Grenze die Geschwindigkeit massiv gedrosselt – im Test bei T-Mobile etwa nach 5 GB/Monat auf maximal 128 kbit/s. “Damit lassen sich zwar Kostenfallen vermeiden, diese Logik von ,unlimitiert’ erschließt sich uns aber nicht”, so Kolba.
Über eine weitere freizügige Auslegung des Begriffes “unlimitiert” durch T-Mobile hat dagegen das OLG Wien vor kurzem entschieden: Dieses verbot die Werbung für den Tarif Fairclick, welche den Eindruck erweckte, dass mit Zahlung der Grundgebühr ein unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung steht. Tatsächlich war das Datenvolumen auf 10 GB pro Monat begrenzt; für jedes weitere heruntergeladene MB wurden 10 Cent verrechnet – ein Mehr an 100 Euro pro GB. “Dieses Beispiel zeigt, dass der VKI immer wieder erfolgreich nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb vorgeht und auch in Zukunft werden wir alles unternehmen, um irreführender Werbung einen Riegel vorzuschieben”, so Kolba abschließend.
Alle Details zum Test gibt es im April-”Konsument” sowie online.
 Wer im Internet einkauft, sollte unbedingt darauf achten, dass er dabei Sicherheitsstandards einhält. Darauf weisst der TÜV Rheinland hin. Eine kürzlich veröffentlichte, repräsentative Studie von Forsa im Auftrag des Branchenverbands Bitkom ergab, dass im vergangenen Jahr bereits jeder sechste in Deutschland Bezahlverfahren im Internet nutzte. “Das internationale Zertifikat PCI DSS mit dem Payment Card Industry Security Standard stellt hohe Anforderungen an den Dienstleister. Darauf kann man sich verlassen”, sagt TÜV Rheinland-Experte Michael Sax. Generell gilt: Je weniger Informationen der Internetnutzer preisgibt, desto geringer ist das Risiko. “Ist die Kontonummer einmal im Netz in falsche Hände geraten, wird sie unter Umständen immer weiter verbreitet”, erklärt Sax.
Wer im Internet einkauft, sollte unbedingt darauf achten, dass er dabei Sicherheitsstandards einhält. Darauf weisst der TÜV Rheinland hin. Eine kürzlich veröffentlichte, repräsentative Studie von Forsa im Auftrag des Branchenverbands Bitkom ergab, dass im vergangenen Jahr bereits jeder sechste in Deutschland Bezahlverfahren im Internet nutzte. “Das internationale Zertifikat PCI DSS mit dem Payment Card Industry Security Standard stellt hohe Anforderungen an den Dienstleister. Darauf kann man sich verlassen”, sagt TÜV Rheinland-Experte Michael Sax. Generell gilt: Je weniger Informationen der Internetnutzer preisgibt, desto geringer ist das Risiko. “Ist die Kontonummer einmal im Netz in falsche Hände geraten, wird sie unter Umständen immer weiter verbreitet”, erklärt Sax.