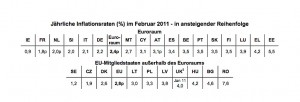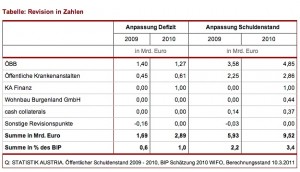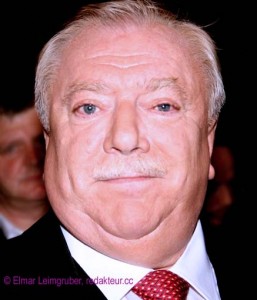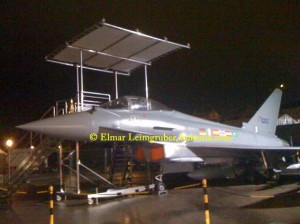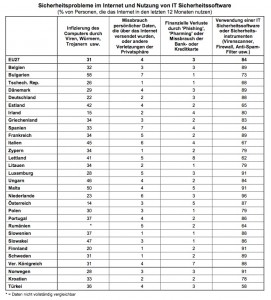Künftig müssen EU-Abgeordnete im Anhang ihrer legislativen Berichte einen “”legislativen Fußabdruck” hinterlassen, also ihre Kontakte zu Lobbyisten nennen: Das EU-Parlament hat am 11. Mai 2011 einem gemeinsamen Register von Parlament und EU-Kommission für Lobbyisten und andere Interessengruppen zugestimmt. Zudem wird der Ministerrat aufgefordert, an dem Register teilzunehmen, das nach Ansicht der Abgeordneten verpflichtend sein sollte. Parlament und Kommission konnten sich jedoch nicht drüber einigen, dass die Registrierung verpflichtend wird. Um eine Akkreditierung im Europäischen Parlament zu erhalten, bleibt eine Registrierung allerdings zwingend notwendig.
Künftig müssen EU-Abgeordnete im Anhang ihrer legislativen Berichte einen “”legislativen Fußabdruck” hinterlassen, also ihre Kontakte zu Lobbyisten nennen: Das EU-Parlament hat am 11. Mai 2011 einem gemeinsamen Register von Parlament und EU-Kommission für Lobbyisten und andere Interessengruppen zugestimmt. Zudem wird der Ministerrat aufgefordert, an dem Register teilzunehmen, das nach Ansicht der Abgeordneten verpflichtend sein sollte. Parlament und Kommission konnten sich jedoch nicht drüber einigen, dass die Registrierung verpflichtend wird. Um eine Akkreditierung im Europäischen Parlament zu erhalten, bleibt eine Registrierung allerdings zwingend notwendig.
Ein gemeinsames Register der beiden Institutionen wird nach Ansicht der Abgeordneten die Transparenz erhöhen. Da alle Informationen an einem Ort gefunden werden können, sind die Bürger leichter in der Lage festzustellen, welche Akteure sich in Kontakt mit den Organen befinden. Das System wird auch die Aufgaben der Interessenvertreter erleichtern, die sich lediglich einmal registrieren müssen.
Das sogenannte “Transparenz-Register” wird die beiden bereits existierenden Register, eines des Parlaments und eines der Kommission, zu einem gemeinsamen Register zusammenführen. Dies haben beide Institutionen im November 2010 beschlossen. Der Änderung des Namens des Registers in “Transparenz-Register” – anstelle des ursprünglichen Namens “Lobbyisten-Register” – wird es etwa Denkfabriken (“think tanks”) oder Organisationen, die Kirchen oder religiöse Gemeinschaften repräsentieren, leichter machen, dem Register beizutreten.
“Das Transparenz-Register ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserem Kampf für eine saubere und verantwortliche Entscheidungsfindung in der Europäischen Union. Wir brauchen Überzeugungsarbeit und Lobbygruppen, um zu wissen, welche Auswirkungen unsere Gesetzgebung auf verschiedene Gruppen von Menschen und Unternehmen haben könnte, aber wir müssen sicher stellen, dass niemand Entscheidungen durch unerlaubte Mittel beeinflusst”, sagte Parlamentspräsident Jerzy Buzek. Der Berichterstatter Carlo Casini (EVP, Italien) sagte in der Debatte am Dienstag, dass die angenommenen Texte “ein erster Schritt hin zu mehr Transparenz sind”. Er fügte hinzu, dass dies ein eindeutiger Hinweis auf unsere Verpflichtung zu den Werten der Transparenz sei.
Das EU-Parlament hat seit 1998 ein Lobbyregister, die Kommission seit 2008. In einer Entschließung aus dem Jahr 2008 hat das Parlament ein gemeinsames Register gefordert, auch für den Ministerrat. Parlament und Kommission haben anschließend eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, und sich im November 2010 auf die Modalitäten eines gemeinsamen Registers geeinigt. Das gemeinsame Register soll im Juni 2011 online zugänglich sein.
Beide Berichte wurden per Handzeichen angenommen.