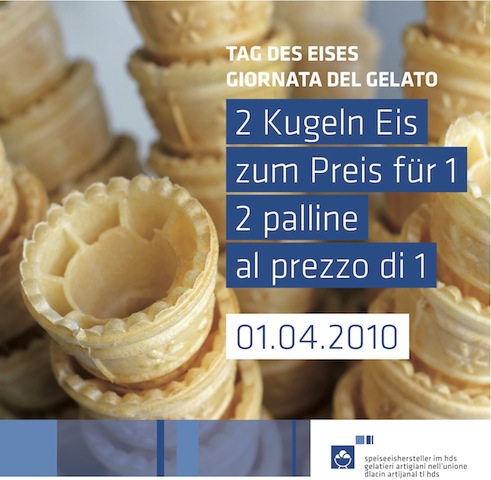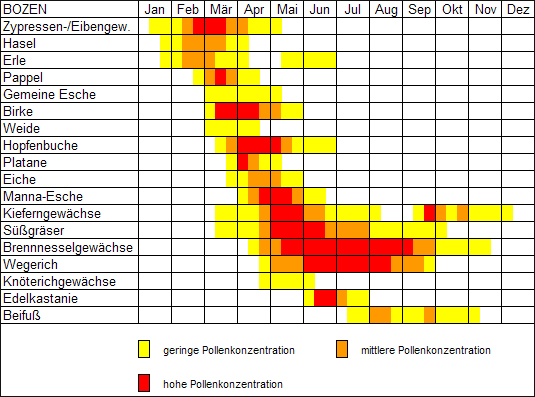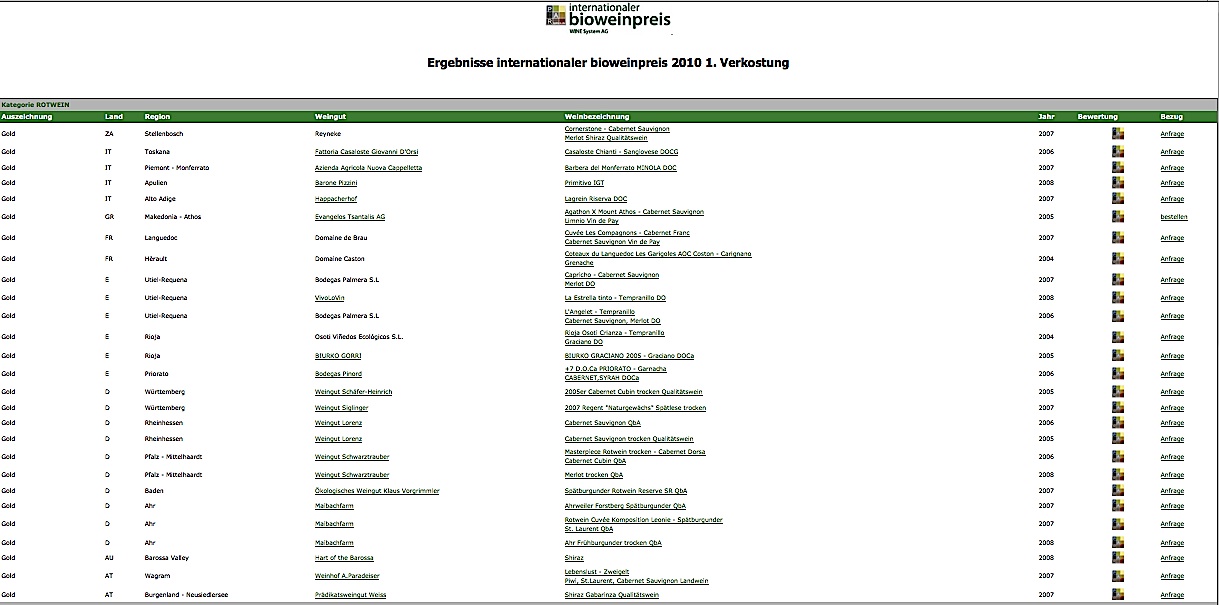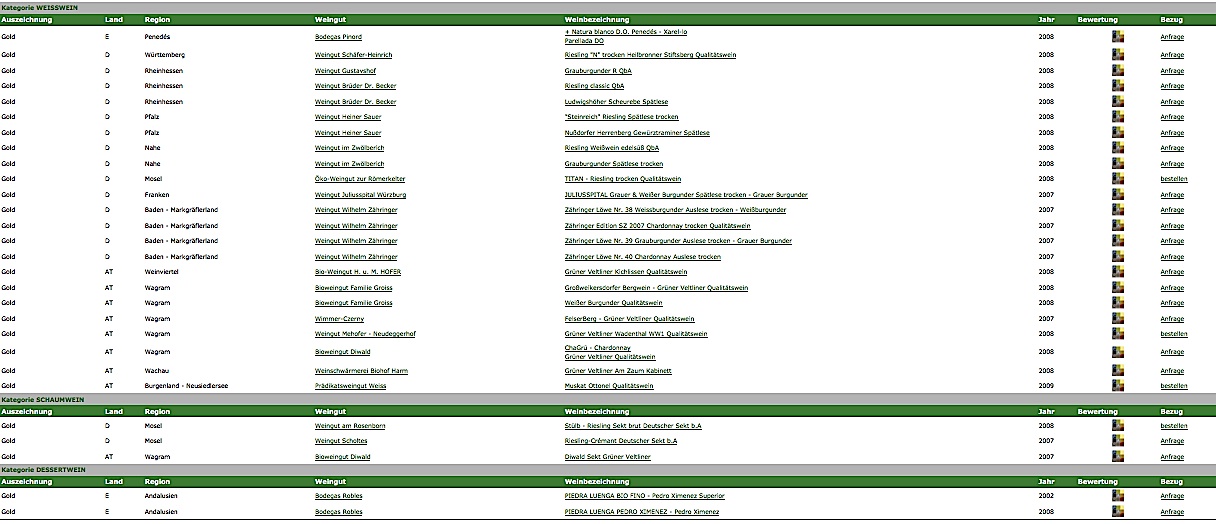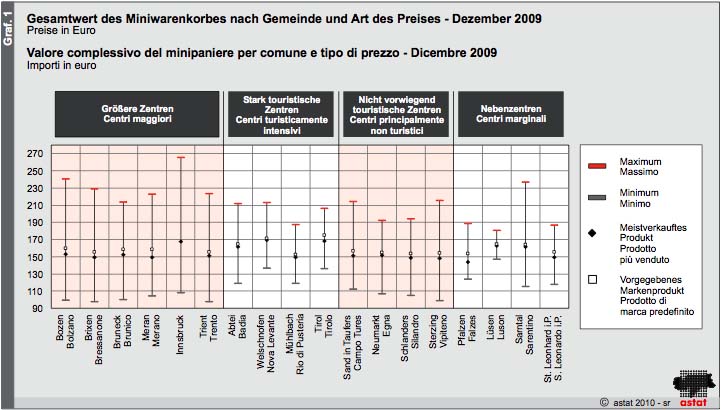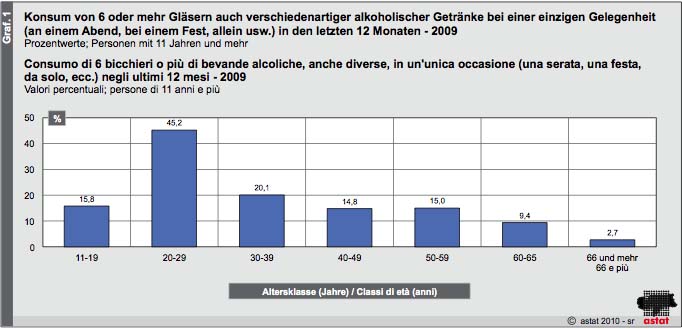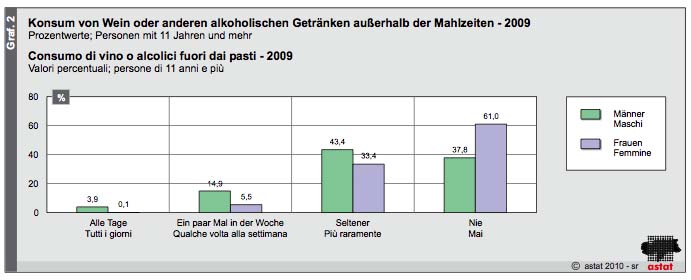- EU-Kommission genehmigt Gen-Kartoffel Amflora
Foto: global2000.at
(Info zuerst und mein Kommentar dazu anschliessend in kursiv)
Die Gen-Kartoffel Amflora darf künftig (zumindest 10 Jahre lang) in der EU “für industrielle Zwecke” angebaut und als Futtermittel verwendet werden. Dies hat die EU-Kommission am 2. März 2010 beschlossen und publiziert. Ausserdem dürfen auch drei genmodifizierte Maissorten in die EU importiert, verarbeitet werden und hier sowohl als Futter als auch als Lebensmittel verwendet werden. Künftig sollen zudem die EU-Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, ob sie den Anbau einzelner Sorten zulassen wollen oder nicht. Bis Sommer will die Kommission einen Vorschlag machen, wie das bestehende, wissenschaftlich basierte EU-Zulassungsverfahren um nationale Entscheidungsfreiheiten ergänzt werden kann. Global 2000, Greenpeace und Südtirol protestieren.
“Nach einem umfassenden, im Jahr 2003 eingeleiteten Zulassungsverfahren und aufgrund mehrerer befürwortender wissenschaftlicher Gutachten hat die Kommission die Zulassung für Amflora erteilt”, schreibt der für Gesundheit und Konumentenfragen zuständige Kommisar John Dalli: Diese genetisch veränderte Kartoffelsorte soll für die Gewinnung einer (z. B. in der Papierproduktion einsetzbaren) Industriestärke genutzt werden. Diese innovative Technologie optimiert den Produktionsprozess und senkt den Verbrauch an Rohstoffen, Energie, Wasser und mit Erdöl hergestellten chemischen Produkten. Der Beschluss enthält strenge Vorgaben für den Anbau, damit nach der Ernte keine genetisch veränderten Kartoffeln auf dem Acker liegen bleiben und damit sich die Amflorasamen nicht in der Umgebung ausbreiten. Ein ergänzender Beschluss gilt den bei der Stärkegewinnung anfallenden Nebenerzeugnissen, soweit sie als Futtermittel verwendet werden.
Drei ebenfalls heute von der Kommission angenommene Beschlüsse betreffen die Verwendung der genetisch veränderten Maissorten MON863xMON810, MON863xNK603, MON863xMON810xNK603 als Lebens‑ und Futtermittel sowie deren Einfuhr und Verarbeitung. Die drei Maissorten sind von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) positiv bewertet und dem vollständigen, im EU-Recht vorgesehenen Zulassungsverfahren unterzogen worden. Sie entstehen durch die herkömmliche Kreuzung von zwei bzw. drei Maissorten (MON863, NK603 and MON810), die in der EU bereits als Lebens‑ und Futtermittel sowie zur Einfuhr und Verarbeitung zugelassen sind, obwohl durch Studien nachgewiesen werden konnte, dass bereits diese drei genmanipulierten Maissorten gesundheitsschädlich sein können.
Amflora enthält ein Resistenz-Gen gegen Antibiotika, darunter eines, das zu den wichtigsten Arzneimitteln gegen Tuberkulose gehört. Nach den derzeit gültigen EU-Richtlinien sollen jedoch keine Resistenzgene für medizinisch relevante Antibiotika in Gentech-Pflanzen genutzt werden, zeigt sich die Umweltorganisation Global 2000 entsetzt über die Entscheidung. Trotz Ablehnung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der EU-Arzneimittelbehörde (EMEA) und der Bevölkerung, winkt die EU-Kommission den gentechnisch veränderten Industrie-Erdapfel “Amflora” durch. Durch die Nutzung eines Antibiotika-Resistenzgenes können Krankheitserreger immun und lebenswichtige Antibiotika somit unwirksam werden, kritisiert auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace: “Gen-Pflanzen, welche die menschliche Gesundheit gefährden können, sollten auf keinen Fall angebaut und erst recht nicht verzehrt werden.”
“Die Tatsache, dass “Amflora” heute für industrielle Anwendungen und sogar als Futtermittel zugelassen worden ist, erhöht die Gefahr, dass die Gentech-Knolle in der Lebensmittelkette landet”, schreibt Global 2000: Sogar zwei Wissenschaftler der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) stellten in der Risikobewertung fest, dass der Transfer zwar “unwahrscheinlich”sei, sollte er aber doch stattfinden, wären die Folgen “bislang unabsehbar”, schreibt Global 2000 und kritisiert einerseits den “Kniefall” der EU vor dem Konzern BASF und den neuen österreichisschen Kommissar Hahn, der diese Entscheidung der EU-Kommission “hätte verhindern können”.
Die EU-Mitgliedsstaaten selbst entscheiden zu lassen, ob sie Gentech-Pflanzen auf ihrem Acker zulassen oder nicht, begrüsst die Umweltschutzorganisation. Tierische Produkte, die mit Hilfe von Gentech-Futtermitteln erzeugt wurden, müssten jedoch eindeutig gekennzeichnet werden, und “Gesundheitsminister Stöger muss zumindest für Österreich die Notbremse ziehen und umgehend ein nationales Anbauverbot erlassen,” fordert Globat 2000: “Wenn der gentechfreie Anbau in Österreich abgesichert ist und den KonsumentInnen durch eindeutige Deklaration klar ist, wo sich die Gentechnik in ihren Nahrungsmitteln versteckt, dann werden wir diese Risikotechnologie in ihre Schranken verweisen”.
Einen “Dammbruch” fürchten auch die Südtiroler Landesräte Hans Berger und Michl Laimer nach dem Ja der EU zur Aussaat der gentechnisch veränderten Kartoffel “Amflora”. “Damit ist das Moratorium der EU zu gentechnisch veränderten Sorten gefallen – eine erschreckende Entwicklung”, so die Landesräte, die nun umso stärker auf die Bemühungen setzen, Südtirol gentechnikfrei zu halten.
Zwar gelte das OK der EU für die “Amflora”-Kartoffel derzeit nur für industrielle Zwecke, also nicht für die Lebensmittel-Produktion, trotzdem signalisiere die Entscheidung aber eine neue Ausrichtung in Brüssel: “Seit rund einem Dutzend Jahren hat die EU keine gentechnisch veränderten Sorten zugelassen, dieses Moratorium ist nun beendet worden”, so Laimer, der diese Entwicklung ebenso mit Besorgnis zur Kenntnis nimmt, wie Berger. “Mit dieser Entscheidung ist ein Präzedenzfall geschaffen und der Damm gegen die Aussaat neuen gentechnisch veränderten Saatguts gebrochen”, erklärt der Agrarlandesrat.
Gerade diese Entwicklung in Brüssel zeige, wie wichtig die Bemühungen seien, Südtirol gentechnikfrei zu halten, sind die Landesräte überzeugt. “Derzeit gilt ein generelles Aussaatverbot gentechnisch veränderter Organismen in unserem Land”, so Berger, der ergänzt: “Und sollte dieses Verbot einmal nicht mehr gelten, werden wir über die Richtlinien, die die Koexistenz gentechnisch veränderter und konventioneller Sorten regeln, Mittel und Wege finden, um den Anbau von GVO-Sorten zu verhindern.”
Ich habe zwar grundsätzlich nichts dagegen, wenn genmanipulierte Pflanzen ausschliesslich industriell zur Schädlingsbeskämpfung, Energiegewinnung Klebstoff- oder Papiererzeugung verwendet werden. Eine Zulassung als Futtermittel und erst recht als Lebensmittel ist hingegen äusserst bedenklich und daher bedingungslos abzulehnen, zumal die gesundheitlichen Schäden für Tiere und vor allem Menschen nicht absehbar sind.
Es ist schon mal eine gute Nachricht, dass die EU-Mitgliedsstaaten nun selbst entscheiden können, ob sie genmanipulierte Pflanzen anbauen wollen oder nicht. Und hier erwarte ich mir vor allem von Deutschland, Österreich und Südtirol, dass hier deren Anbau und Import dauerhaft verboten ist und bleibt.
Und natürlich müssen, wie von Global 2000 zu Recht gefordert, alle im Handel erhältlichen Lebens- und Futtermittel auch entsprechend (uneingeschränkt und umfassend!) gekennzeichnet werden, wenn sie gentechnisch veränderte Zutaten enthalten, um das Selbstbestimmungsrecht der Konsumenten auf gentechnikfreie Lebens- und Futtermittel zu wahren.