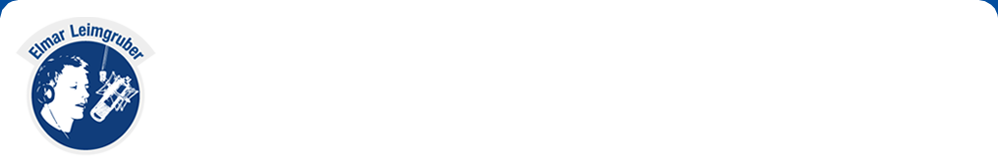Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes die rund um die Uhr, die Samstag, Sonntag, Feiertag und in der Nacht ihren Dienst versehen, würden zu niedrig entlohnt, kritisiert der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Gesundheits- und Sozialberufe, Johann Hable. Um den drohenden Pflegenotstand zu verhindern, fordert die Gewerkschaft von der Bundesregierung mindestens eine Milliarde Euro für einen neu zu schaffenden Pflegefond und die Erhöhung der Nettogehälter um mindestens 25 Prozent.
Dank des hervorragenden Konsumverhaltens der Österreicherinnen und Österreicher konnte der Staat in der ersten Hälfte des Jahres 2010 zusätzlich und unerwartet um 3 Milliarden Euro mehr als veranschlagt einnehmen. Hable fordert daher von der Bundesregierung zumindest eine Milliarde Euro aus diesen Mehreinnahmen in den neu zu schaffenden Pflegefond zur Ausbildungsreform und für mehr Pflegepersonal.
Derzeit verdiene beispielsweise eine diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester ca. Euro 1400,– netto im Monat, nach ca. 20 Dienstjahren Euro
1800,– netto im Monat, nach 30 Dienstjahren ca. Euro 2000,– netto. “Das ist einfach zu wenig und letztlich ein Skandal den man dem Pflegepersonal
zumutet,” betonte Hable. Würden seine Forderungen umgesetzt, würde das Lohnschema künftig so aussehen: für eine Jungdiplomierte rund Euro 1750,– auf die Hand, nach 20 Dienstjahren Euro 2200,– netto und nach 30 Jahren Dienst und Erfahrungsschatz Euro 2500 bis 3000,– netto.
Die Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Österreichs seien überwiegend trägerbezogen und daher würde grundsätzlich aus Kostengründen für den eigenen Trägerbedarf (Krankenhausbedarf) ausgebildet, so dass die Alten- und Pflegeheime als auch die Hauskrankenpflege kein ausgebildetes Personal bekommen, kritisiert die Gewerkschaft weiters: “Der Bedarf an gehobenen Pflegediensten ist da, woher soll das Personal genommen werden?” Dazu komme die Verschärfung, “dass österreichweit Bewerber in den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen abgewiesen werden müssen, da nur 20 bis 30 Ausbildungsplätze pro Krankenpflegeschule für Neuauszubildende aufgenommen werden”. Junge Leute die sehr gerne einen Pflegeberuf ergreifen wollen, würden abgewiesen und somit frustriert.
Sozialminister Rudolf Hundsdorfer möge daher “mehr Ausbildungsmittel für die Pflegeausbildung im Rahmen der AMS-Umschulung” zur Verfügung stellen.
“Derzeit bekommen Ausbildungswillige zwischen Euro 500,– und Euro 800,– vom AMS, das ist viel zu wenig, davon kann keine Familie leben”.
Auch hier muss es zur wesentlichen Anhebung der Zahlungen kommen. Und Gesundheitsminister Alois Stöger wird ersucht “dringend, die längst fällige Ausbildungsreform umzusetzen: Wir brauchen eine moderne, zeitgemäße, effiziente Pflegeausbildung.” Der derzeitige “Wildwuchs” in der Ausbildung schreie nach einem “modernes Berufsgesetz”, betont Hable.
In der Hauskrankenpflege gebe es zwar viele Teilzeitarbeitsmöglichkeiten, jedoch wird Pflegepersonal mit dem Wunsch Vollzeit zu arbeiten abgewiesen, da diese Form angeblich zu teuer käme. Zudem klagten Teilzeitkräfte in der Hauskrankenpflege, dass sie von ihrem Gehalt zwischen Euro 500,– bis
Euro 700,– (viele Alleinerzieherinnen) nicht leben können und daher zusätzlich in der Gastronomie arbeiten müssten. “Auch in diesem Fall hat die öffentliche Hand einen Handlungsbedarf, jammern alleine ist zu wenig, Geld in die Hand zunehmen und zu handeln ist unabdingbar notwendig,” so Hable.